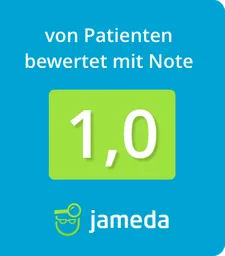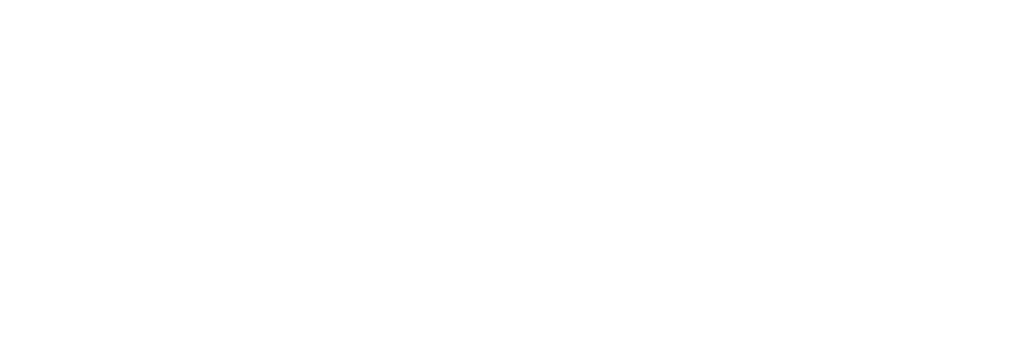Digital Smile Design
Digital Smile Design Das Digital Smile Design ist eine innovative Methode, um Ihr Wunschlächeln zu modellieren. Der Vorteil: Ihre Anforderungen fließen von Anfang an, das

Zahnfleischbluten
Was tun bei Zahnfleischbluten? Die meisten kennen es: plötzliches Zahnfleischbluten beim Zähneputzen. Viele Menschen ignorieren Zahnfleischblutungen und warten, bis sich das Problem von selbst löst.

Unerträgliche Zahnschmerzen – woher sie kommen und was dagegen hilft
Unerträgliche Zahnschmerzen – woher sie kommen und was dagegen hilft Plötzliche Zahnschmerzen beim Kauen, nach der Wurzelbehandlung oder bei Kontakt mit Kälte – wenn die

Was tun bei Zahnstein?
Was tun bei Zahnstein? Ein raues Gefühl auf den Zähnen, gelbliche Ablagerungen auf den Zähnen, Entzündungen des Zahnfleisches – Zahnstein macht sich auf viele Arten

Lachgas beim Zahnarzt – das sollten Sie wissen
Lachgas beim Zahnarzt – das sollten Sie wissen Besonders für Angstpatienten oder für Patienten mit starkem Würgereiz ist der Besuch beim Zahnarzt eine unangenehme Prozedur.

Welche Arten von Zahnimplantaten gibt es?
Welche Arten von Zahnimplantaten gibt es? Die Auswahl an Zahnimplantaten ist groß. Die Optionen reichen von Implantaten bestimmter Marken, über die Wahl des Materials bis

Digital Smile Design
Digital Smile Design Das Digital Smile Design ist eine innovative Methode, um Ihr Wunschlächeln zu modellieren. Der Vorteil: Ihre Anforderungen fließen von Anfang an, das heißt schon vor der eigentlichen Behandlung, in die Planung Ihres neuen Lächelns ein. Möglich ist das durch eine Software, die mithilfe von Aufnahmen Ihres Mundraumes ein individuelles und anpassbares Modell […]

Zahnfleischbluten
Was tun bei Zahnfleischbluten? Die meisten kennen es: plötzliches Zahnfleischbluten beim Zähneputzen. Viele Menschen ignorieren Zahnfleischblutungen und warten, bis sich das Problem von selbst löst. Das ist allerdings alles andere als ratsam, denn unser Zahnfleisch gibt uns wichtige Signale zum Zustand der gesamten Mundgesundheit. Inhalt Welche Ursachen kann Zahnfleischbluten haben? Welche Symptome gehen mit einer […]

Unerträgliche Zahnschmerzen – woher sie kommen und was dagegen hilft
Unerträgliche Zahnschmerzen – woher sie kommen und was dagegen hilft Plötzliche Zahnschmerzen beim Kauen, nach der Wurzelbehandlung oder bei Kontakt mit Kälte – wenn die Zähne schmerzen, steht die Frage nach der Ursache an erster, die Suche nach einer effektiven Linderung und der Bekämpfung der Schmerzen an zweiter Stelle. Zahnschmerzen sind dabei immer ein Zeichen […]

Was tun bei Zahnstein?
Was tun bei Zahnstein? Ein raues Gefühl auf den Zähnen, gelbliche Ablagerungen auf den Zähnen, Entzündungen des Zahnfleisches – Zahnstein macht sich auf viele Arten bemerkbar. Doch wie lässt sich Zahnstein verhindern? Kann man Zahnstein selbst entfernen? Und welche Folgen hat es, wenn Zahnstein unbehandelt bleibt? Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig zu […]

Lachgas beim Zahnarzt – das sollten Sie wissen
Lachgas beim Zahnarzt – das sollten Sie wissen Besonders für Angstpatienten oder für Patienten mit starkem Würgereiz ist der Besuch beim Zahnarzt eine unangenehme Prozedur. Eine Lachgasbehandlung beim Zahnarzt kann eine gute Möglichkeit sein, Ängste erträglich zu machen und die Zahnbehandlung stressfrei zu überstehen. Inhalt Was ist Lachgas? Wozu Lachgas beim Zahnarzt? Wie läuft die […]

Welche Arten von Zahnimplantaten gibt es?
Welche Arten von Zahnimplantaten gibt es? Die Auswahl an Zahnimplantaten ist groß. Die Optionen reichen von Implantaten bestimmter Marken, über die Wahl des Materials bis hin zur Art des Implantates. Viele Patienten fühlen sich bei dieser Vielfalt an Alternativen erst einmal überfordert. Bei der Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Modell hilft es, sich erst […]